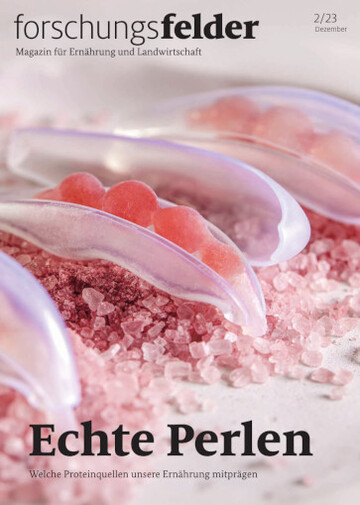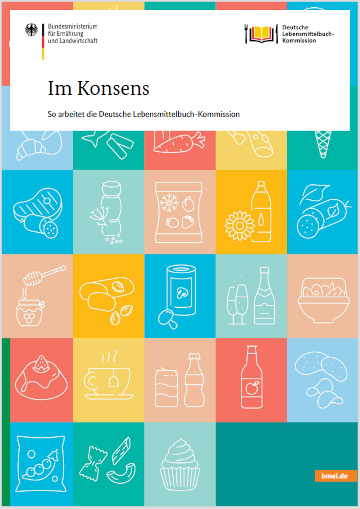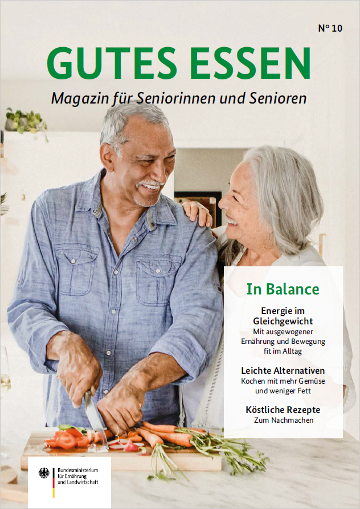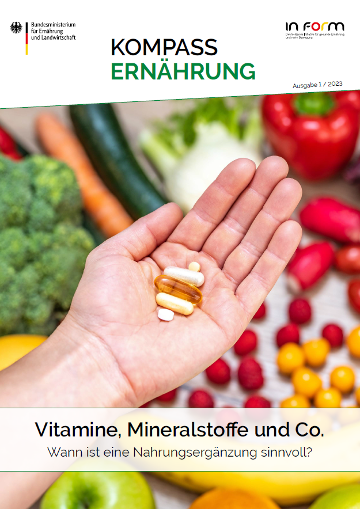Um für Landwirtinnen und Landwirten Planungssicherheit zu schaffen, braucht es eine verlässliche langfristige Unterstützung.
Rede von Bundesminister Cem Özdemir auf dem Tönnies Forschungs-Symposium am 11. März 2024 in Berlin
Es gilt das gesprochene Wort!
Anrede,
vielen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen auch ausdrücklich dafür, dass ich hier auf Armin Laschet treffe. Uns beide verbindet ja weit mehr als ein kollegiales Verhältnis. Ja, das gibt es: Freundschaft über Parteigrenzen hinweg! Es wäre ja eigentlich nicht der Rede wert – aber in diesen Zeiten, die ja manchmal allzu unversöhnlich daherkommen, darf man das schon mal betonen.
Als Kind Baden-Württembergs habe ich ja einen ganz eigenen Blick auf den Konservatismus. Das Ländle wurde ja zu meinen Lebzeiten von CDU-Ministerpräsidenten regiert, bevor 2011 Winfried Kretschmann Ministerpräsident wurde. Was die CDU damals in Baden-Württemberg war, war quasi strukturell die SPD in Nordrhein-Westfalen. Natürlich habe ich mich als junger Kerl auch ordentlich an der CDU von Lothar Späth und Erwin Teufel gerieben.
Aber eines habe ich eben auch früh begriffen: Wahrhaftig konservativ zu sein, das bedeutet eben auch, überzeugter Demokrat und Europäer zu sein! So wie es Armin Laschet verkörpert. Und so wie er es gerade erst Ende Januar bei der großen Demonstration in Aachen mit seiner Rede eindrucksvoll gezeigt hat. Als Ministerpräsident ist er a. D., also außer Dienst – als Demokrat und Europäer ist er hingegen 24 Stunden im Dienst. Dafür danke ich Dir als Kollege und Freund, lieber Armin!
Jetzt habe ich mit dem Mythos aufgeräumt, dass ein Grüner und CDUler nicht befreundet sein können. Dann kann ich gleich noch mit einem weiteren Mythos aufräumen: Nein, ich bin hier auf dieser Veranstaltung nicht in Feindesland. Das sind so die üblichen Klischees: "Was, Du gehst zu Tönnies? Du? Als Grüner? Als Vegetarier?". Als ob es darum ginge, dass ein Schalker auf der Dortmunder Südtribüne sein Zelt aufschlägt. Außerdem bin ich weder als Grüner noch als Sellerieschnitzel-Minister hier, sondern als Bundeslandwirtschaftsminister, der Land und Bevölkerung verpflichtet ist. Und es gibt doch kaum ein Thema, das mich im Amt von Anfang an so sehr umtreibt, wie die Zukunft unserer Nutztierhaltung.
Wir stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Wir müssen eine produktive Landwirtschaft betreiben und die Ernährung der Menschen sichern – aber ohne dabei die eigenen Produktionsgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Artenvielfalt und Klima zu schädigen. Dabei muss auch die Nutztierhaltung ihren Beitrag zum Schutz unserer Lebensgrundlagen leisten. Und zugleich brauchen wir sie, um in möglichst geschlossenen Kreisläufen zu wirtschaften. Wenn uns das gelingt, dann kann eine krisenfeste, nachhaltige Tierhaltung ihren Teil dazu beitragen, unsere Ernährung zu sichern, die Perspektiven der Bauernhöfe und Betriebe zu verbessern und auch die Kraft des ländlichen Raums zu stärken.
Meine Damen und Herren,
ich wurde um eine Darstellung "grundsätzlicher Überlegungen jenseits der aktuellen Tagespolitik" gebeten, die eine "dauerhafte Befriedung der Debatte" deutlich werden lässt. Ich möchte diese grundsätzlichen Überlegungen in Form von fünf Thesen mit Ihnen teilen.
Meine erste These betrifft unsere Diskussionskultur: Tierhaltung und Fleischkonsum sind ein gefundenes Fressen für alle, die ganz bewusst polarisieren wollen. Zu akzeptablen Lösungen kommen wir aber nur dann, wenn die Vernünftigen dieser Polarisierung widerstehen, weil wir sonst unsere politische Kultur vergiften.
Tierhaltung und damit zusammenhängend auch der Fleischkonsum sind ein emotionales Thema. Ich bin ja immer mal wieder damit konfrontiert, dass ich den Leuten angeblich das Schnitzel wegnehmen möchte. Oder umgekehrt höchstpersönlich für das Leid von Tieren verantwortlich gemacht werde. Deshalb möchte ich zu Beginn eines unmissverständlich betonen: Es geht bei der Nutztierhaltung nicht um ein "ob", sondern um das "wie".
Und diese Zuspitzung sei mir dann doch gestattet: Zwischen (der Tierrechtsorganisation) PETA auf der einen Seite und Hubert Aiwanger auf der anderen gibt es viel Raum für vernünftige Lösungen – dessen bin ich mir ganz sicher und Sie hoffentlich auch. Die Vernünftigen sind dann aber auch gefordert, den Polarisierern unterschiedlicher Couleur klar und deutlich zu widersprechen. Ich erläutere Veganern auch, dass ihr Gemüse Tierhaltung und den tierischen Dünger braucht! Stichwort Kreislaufwirtschaft. Oder dass die Kuh eine großartige Erfindung unseres Herrgotts ist, wie Winfried Kretschmann es mal unnachahmlich auf den Punkt gebracht hat. Warum? Weil sie Gras, das für die menschliche Ernährung ungeeignet ist, in so Großartiges wie Milch verwandelt, Käse, Joghurt, Butter und auch Rindfleisch ermöglicht. Das muss man den Menschen erklären. Die Aufklärung ist ohnehin ein nie endendes Projekt.
Zweitens: Der Zweck heiligt nicht die Mittel – weder beim Klimaschutz noch bei der Durchsetzung von Partikularinteressen. Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung sind von fundamentaler Bedeutung für unsere Identität und unser Zusammenleben. Sie gelten in der gebotenen Abwägung natürlich auch, wenn es um Ernährung und damit indirekt auch um Tierhaltung geht. Niemand wird gerne bevormundet. Wahlfreiheit ist essenziell für die Akzeptanz von Veränderung. Allerdings hat allein schon die Tatsache, dass die Bundesregierung im Januar eine Ernährungsstrategie vorgelegt hat, dazu geführt, dass manche so tun, als sei damit ein Zwang zu einer bestimmten Ernährung verbunden – was schlichtweg Blödsinn ist. Es muss immer um Empfehlungen und Wahlfreiheit gehen – aber eben um echte und faire Wahlfreiheit, die verschiedenen und sich wandelnden Ernährungsgewohnheiten gerecht wird. Und dazu gehört selbstverständlich auch Fleisch, gerne aus deutscher Tierhaltung.
Zugleich sehen wir seit mehreren Jahren, dass der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch sinkt. Nehmen wir nur einmal das Beispiel Schweinefleisch: Lag der Pro-Kopf-Verzehr 2010 noch bei 40 Kilogramm, waren es 2022 noch 29 Kilogramm. Diese Entwicklungen finden in unserer Gesellschaft längst statt und verändern Märkte, weil die Verbraucher selbstbestimmt so entscheiden – und zwar ganz ohne das Zutun eines Landwirtschaftsministers. Aber es geht nicht nur um Freiheit und Selbstbestimmung heute – es geht auch um Freiheit und Selbstbestimmung morgen und übermorgen.
Und das führt mich zu drittens: Wenn wir unsere Lebensgrundlagen bewahren und auch Tieren als unseren Mitgeschöpfen gerecht werden wollen, werden wir weniger Tiere halten und diese Tiere auch besser halten müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur im November ein bedeutendes Urteil gesprochen, sondern auch schon im April 2021. Es hat festgestellt, dass wir in der Gegenwart CO2-Emmissionen einsparen müssen, damit auch die Jüngeren später in Freiheit leben können – kurzum: dass wir bessere Vorfahren werden müssen. Wir entscheiden heute über die Freiheit unserer Kinder morgen – und das eben auch über die CO2-Emissionen in der Tierhaltung. Und daraus folgt, dass wir weniger Tiere halten und diese auch besser halten. Das ist jetzt keine verrückte Idee eines grünen Landwirtschaftsministers, sondern die Erkenntnis der Wissenschaft. Ich zitiere stellvertretend Prof. Harald Grethe: "Um der Klimakrise zu begegnen, müssen wir viel weniger Fleisch und Milchprodukte essen und produzieren." Oder Prof. Wilhelm Windisch, der morgen früh zu Ihnen sprechen wird: "Wir werden [aber] auf jeden Fall weniger Fleisch essen und auch weniger Milch trinken als heute." Ich betone: Keiner der beiden sagt "kein Fleisch", sondern "weniger Fleisch". Tiere besser zu halten, kostet Geld.
Und das führt mich zu viertens: Wenn wir unsere Lebensgrundlagen bewahren wollen, müssen wir nicht nur weniger Tiere halten und diese Tiere auch besser halten – wir müssen die Landwirtinnen und Landwirte für ihren Aufwand auch fair entlohnen. Sonst wird das alles nicht funktionieren. Mit dem Bundesprogramm zur Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Tierhaltung haben wir jetzt einen Anfang gemacht. Das Programm läuft seit Anfang März. Für den Start des Umbaus der Schweinehaltung steht eine Milliarde Euro über den Bundeshaushalt zur Verfügung. Ja, es stimmt, die Borchert-Kommission hat 3 bis 4 Milliarden Euro veranschlagt – aber für alle Tierarten und alle Haltungsformen, während wir mit der Schweinehaltung starten. Damit unterstützen wir Betriebe, die ihre Ställe für eine tier- und umweltgerechtere Haltung umbauen wollen. Wir unterstützen sie auch bei den laufenden Mehrkosten für mehr Tierwohl.
Um die benötigte Planungssicherheit für die Betriebe zu gewährleisten, beläuft sich die Förderlaufzeit auf sieben Jahre. Die vom BMEL angestrebte Förderlaufzeit von zehn Jahren wurde von der EU im Rahmen der Notifizierung aus rechtlichen Gründen nicht genehmigt. Eine Verlängerung bzw. Neuauflage der Förderung nach dem Ende des Sieben-Jahre-Zeitraums ist aber möglich. Gleichzeitig ist klar: Das kann nur der Anfang sein. Wir reden beim Wandel der Tierhaltung von hohen Investitionen. Da reicht es nicht, bis ans Ende der Wahlperiode zu denken.
Und das führt mich zu fünftens: Um für Landwirtinnen und Landwirten Planungssicherheit zu schaffen, braucht es eine verlässliche langfristige Unterstützung. Genau das können wir mit einem Tierwohl-Cent schaffen, wie ihn die Borchert-Kommission vorgeschlagen. Ich möchte es klipp und klar sagen: Mehr Tierwohl kostet Geld – und wenn der Staat nicht bereit ist, hier zu unterstützen, dann wird das Konsequenzen haben. Kein Landwirt wird in Tierwohl investieren, wenn er damit rechnen muss, dass die Konsumenten nicht bereit sind, für den Mehraufwand aufzukommen. Denn was der Bürger in einer Umfrage sagt, ist das eine – wie er sich im Laden tatsächlich verhält, mitunter etwas ganz Anderes. Das können sie nicht einfach dem Markt überlassen, schon gar nicht in einem offenen Markt, wo das Fleisch dann aus dem Ausland kommt – und dann auch eher nicht aus besserer Tierhaltung, um es vorsichtig zu formulieren.
Ich bin überzeugt, dass wir als Staat unserer Verantwortung gerecht werden müssen, selbst aktiv Tierwohl zu fördern. Zumal wir damit zugleich in Klimaschutz, in die Zukunft der Höfe und in den ländlichen Raum investieren. Das ist doch eine klassische win-win-Situation. Deshalb habe ich einen Vorschlag für einen Tierwohl-Cent unterbreitet. Angesichts der Bauernproteste und der Aufmerksamkeit für die Landwirtschaft gibt es jetzt ein Zeitfenster. Man kann meinen Vorschlag natürlich ablehnen – aber dann muss man einen anderen machen, der umgesetzt werden kann. Es gäbe ja auch die Möglichkeit über die Mehrwertsteuer. Aber immer nur "Nein" zu sagen zu allen Vorschlägen, ist dann eben auch eine Antwort auf die Frage: "Quo vadis Nutztierhaltung". Aber es ist die falsche Antwort.
Meine Damen und Herren,
im Bereich der Landwirtschaft braucht es bei grundsätzlichen Fragen größere Mehrheiten, damit Entscheidungen über Wahlperioden hinweg Bestand haben. Nur so haben Landwirte Planungssicherheit. Die Borchert-Kommission hat in einem breiten Konsens Gegensätze überwunden, Kompromisse erarbeitet und Wege gewiesen. Als sie ihren Bericht vorgelegt hat, waren die Zinsen bei 1 Prozent und die Inflationsrate lag bei 0,5 Prozent. Die finanzielle Lage des Staates war eine wesentlich bessere als heute. Der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt – und weder ein Olli Kahn noch ein Manuel Neuer standen im Tor. Das Tor war vielmehr leer – und trotzdem hat die damalige Regierung sich geweigert, den Ball im Tor zu versenken. Jetzt ist die Lage eine ganz andere und dennoch müssen wir zu Lösungen kommen – im Sinne der Landwirte und Betriebe, der Tiere und des Klimaschutzes. Ich habe ja geflissentlich den Teil meines Redetitels ignoriert, wo es um die Erwartungen der Politik an Industrie und Handel geht – momentan ist es doch so, dass die Politik erst mal gute Rahmenbedingungen schaffen muss. Wenn ich aber eine Erwartung äußern soll, dann die, dass sie die ihnen nahestehenden Parteien daran erinnern, dass sich alle bewegen müssen, damit wir zu einem Konsens kommen und ihn umsetzen können. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, dass man von der Demokratie keine Wunder erwarten dürfe. Das tue ich auch nicht. Alles, was ich erwarte, ist gesunder Menschenverstand, Vernunft und Kompromissbereitschaft – und zwar zum Wohle unseres Landes.
Vielen Dank!
Ort: Berlin